
Die Archetypen der Femme fatale















Bevor Aphrodite mit ihrem Porzellankörper dem Meeresschaum entstieg, ließ Monique Wernbacher von einem jungen Graffitti-Künster den Hintergrund sprayen. Wogende Musik führt bis zum reinsten Klang.
Geheimste Wünsche gereifter Herren? Lolita räkelt sich im Ambiente einer altenglischen Bibliothek, Nacktheit trifft auf korrekten Businessanzug, junge Haut auf Büffelleder. Metallisches Kaminbesteck als Instrumentarium Feuer zu schüren, warme Weichheit der görenhaften Kindfrau entzündet lodernde Leidenschaft – bei seriöser Klaviertradition.
Martialisch unterwegs im stilisierten Wald: Energien quellender, unerfüllter Fleischeslust führen zur Flucht in die Androgynität – sehnig gestylter Body, die Frau steht ihren Mann: Artemis oder römisch: Diana, die Göttin der Jagd.
Monique Wernbacher zitiert die Attribute der Sphinx: Frau, Löwe und Vogel in einer Gestalt als Symbol animalischer Gier.
Wasserfarben, Klänge fallender Tropfen und klirrenden Gelächters zeigen Undines verhängnisvolle Verführung in ihrem Element Wasser, todbringend für Irdische.
Pandora, das göttliche Artefakt, hebt sich von steinerner Naturkulisse ab, Marimbaklänge vermitteln entrückende Hitze. Ein unverfälschtes Farbenspiel, das die Fotokünstlerin hier festhielt.
Jazzige Clubmusik der 30er Jahre und mittendrin Kirke, die Bezirzende. Transparenz wird zur Verheimlichung, reizvollen Andeutung. Schattenspiele und Durchblicke, Verlocken und Lust, Verbot und Erfüllung, in steter Gefahr.
In fließendem Gold gibt sich Helena den Werbern hin, unbeeindruckt vom Kriegsgeschehen, das sie auslöst. In götterhafter Grazie bleibt sie selbstbezogen ihr eigener Mittelpunkt.
Was ist Leben, was Imago? Monique Wernbacher stellt Medusa vor Spiegel, die bis ins Unendliche widerspiegeln: Die vielen Ichs, outriert bis zur tödlichen Erstarrung.
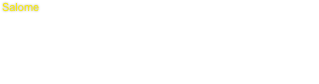
Ein Palazzo auf Sizilien, im Besitz direkter Barbarossa-Nachfahren, in morbid-staubiger Szenerie: Hier führte Monique Wernbacher Regie für ihre „Venus im Pelz“. Verruchtes unter dem Zeichen des Kreuzes, Spiel und Qual, bis Domina und Sklave im goldenen Bett versinken.
Die moderne Vampirin, die Untote, wird als skulpturale Jugendstilgestalt in den Schacht zwischen Leben und Tod gestellt – Carmilla erwacht zur Blauen Stunde und tritt im Rot-Schwarzen Bühnenkostüm auf. In scheinbar unterkühlter Emotion schlägt sie ihre Zähne in das Fleisch ihrer Gesellen, symbolisch dargestellt durch ein blankes Stilett.
Hier stellt Monique Wernbacher eine „Anti-Femme fatal“ vor: Maria. Abgekoppelt von Klischees, eine Provokation? Als Sinnbild der unantastbaren, reinen Frau auf einem Podest, die ihre Ansprüche aufgegeben hat und (deshalb?) für andere als Helfende da sein kann und soll.
Ⓒ Monique Wernbacher, 2008 2008
Alle Rechte vorbehalten
Texte: Sylvia Nachtmann